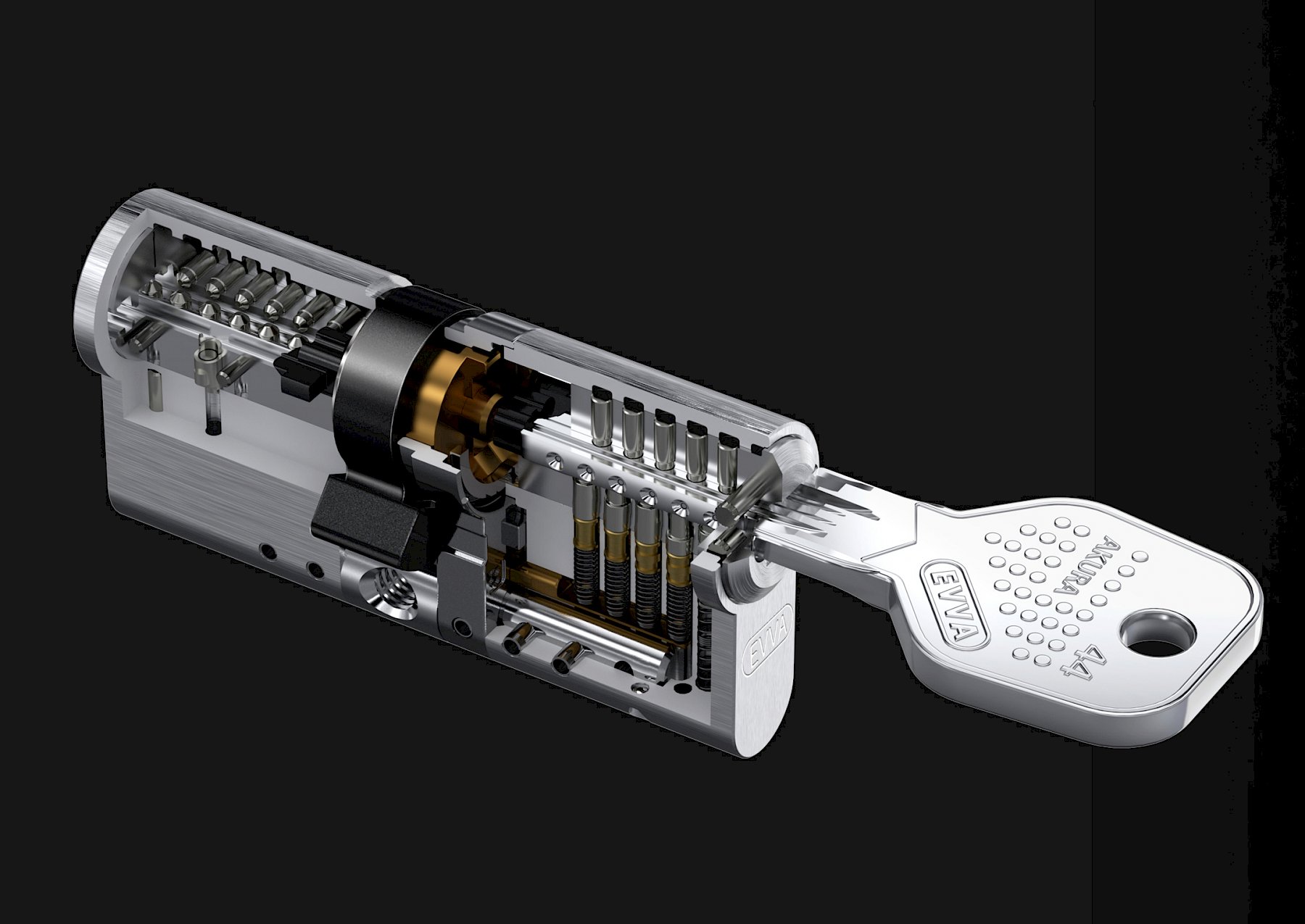SD: Ihr habt sehr hohe Qualitätsstandards betreffend Material und Verarbeitung, die ausschließlich in Europa erfolgt. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Preisexplosionen auf eure Produktion?
HT: Wir produzieren in Italien und beziehen unsere Polster aus Slowenien. Von der Preisexplosion spüren wir noch wenig. Mag sein, dass sich in den Transportkosten einiges niederschlägt, aber sonst sind wir davon noch nicht betroffen.
SD: Wie sehen eure kurzfristigen und langfristigen Pläne für die Zukunft aus?
HT: Wir müssen wachsen und möchten uns weiter öffnen. Dazu gehört, dass wir Schauräume einrichten werden, gerne auch in Verbindung mit Cafés. Wir wollen zeigen, dass unsere Produkte funktionieren und sich für das Projektgeschäft eignen.
SD: Nach welchen Kriterien sucht ihr die Partner für eure zeitgenössischen Designs aus, oder fliegen euch die Gelegenheiten quasi zu?
HT: Wir haben verschiedene Herangehensweisen, aber oft erfolgen die Kontakte aus unserem direkten oder erweiterten Umfeld, wie aktuell die Zusammenarbeit mit der Designerin Magdalena Casadei.
SD: Könntet ihr beschreiben, welche Entwicklungen im zeitgenössischen Design ihr aktuell spannend findet? Laienhaft betrachtet, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es noch einen weiteren Stuhl braucht, wo es doch schon so viele Modelle gibt.
HT: TYP ist mehr auf den Lifestyle-Markt ausgerichtet als darauf, neue Möbel zu entwickeln. Dabei wollen wir aber nicht zwingend trendig sein, sondern schauen auch gerne in die andere Richtung als die meisten Mitbewerber, auch wenn das vielleicht arrogant klingt.
SD: Das finde ich nicht, aber lässt sich das präzisieren? Zeichnet sich das Antizyklische eurer Ausrichtung durch den Blick in die Vergangenheit aus, oder gibt es noch andere Faktoren, die euch antreiben?
HT: Ich glaube, es ist eine Mischung. In erster Linie fragen wir uns, warum sollte man neue Designs produzieren, wo es doch so viele perfekte, alte Entwürfe gibt, die nie produziert wurden. Das trifft etwa bei Diekmann zu und dann gibt es die andere Herangehensweise wie bei Klemens Schillinger: Uns schwebte ein Stuhl in eine bestimmte Richtung vor und als wir ihn zufällig in einer Galerie sahen, war klar, dass der gut in unsere Kollektion passt. Wir blicken nicht strategisch in die Zukunft, sondern kultivieren diesen impulsiven Zugang, der es uns erlaubt, Dinge zu mischen. Wir sehen etwas und sagen: Das ist super. Das machen wir.